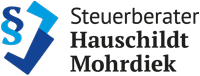Aktuelle Informationen rund um das Steuerrecht
Nichts ändert sich schneller als die Steuergesetzgebung!
Ob nun als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, als Hausbesitzer, Unternehmer oder Freiberufler: Wir behalten gemeinsam mit Ihnen den Überblick über die sich ständig ändernde Rechtslage! Druckfrische Informationen zu den unterschiedlichen Themengebieten haben wir Ihnen hier zusammengestellt. Bei Fragen melden Sie sich gerne!
Steuertermine
- Steuertermine September 2025
| 10.09. | Umsatzsteuer Lohnsteuer* Solidaritätszuschlag* Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer** Solidaritätszuschlag** Kirchensteuer ev. und r.kath.** |
Zahlungsschonfrist: bis zum 15.09.2025. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für August 2025; ** für das III. Quartal 2025]
| Information für: | - |
| zum Thema: | - |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- 1-Prozent-Versteuerung von Dienstwagen: Selbst getragene Fährkosten für Urlaubsreise sind nicht vorteilsmindernd
- Fahrten zur Arbeit: Wann greift die Pendlerpauschale, wann der Reisekostenabzug?
- Fortbildungen richtig absetzen: Was Arbeitnehmer beim Werbungskostenabzug beachten sollten
- Werbungskosten: Tätigkeitsstätte eines Berufssoldaten
Dürfen Arbeitnehmer ihren Dienstwagen auch für private Zwecke nutzen, versteuern sie diesen geldwerten Vorteil häufig nach der sog. 1-Prozent-Regelung. Sofern sie sich selbst an den Kosten des Dienstwagens beteiligen, können sie diese Zuzahlungen häufig von ihrem zu versteuernden Nutzungsvorteil abziehen. Eine solche Kostenbeteiligung ist häufig ein Weg, um den Dienstwagen mit zusätzlicher Sonderausstattung zu versehen, die der Arbeitgeber selbst nicht bezahlt hätte.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun aber bekräftigt, dass selbst getragene Aufwendungen des Arbeitnehmers nur dann vorteilsmindernd abgezogen werden dürfen, wenn sie bei einer (hypothetischen) Kostentragung durch den Arbeitgeber Bestandteil dieses Vorteils wären, so dass sie von der Abgeltungswirkung der 1-Prozent-Regelung erfasst würden. Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der seinen 1-Prozent-Vorteil um selbst getragene Fährkosten mindern wollte, die ihm auf einer privaten Urlaubsfahrt entstanden waren.
Die Bundesrichter wiesen jedoch darauf hin, dass Maut-, Fähr- und Parkkosten, die einem Arbeitnehmer auf Privatfahrten entstehen, einen eigenständigen geldwerten Vorteil begründen, wenn sie vom Arbeitgeber übernommen würden. Sie wären in diesem Fall nicht vom pauschal ermittelten 1-Prozent-Vorteil gedeckt. Daraus ergibt sich nach Gerichtsmeinung, dass der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers aus der Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs nicht gemindert werden kann, wenn der Arbeitnehmer diese Aufwendungen selbst trägt. Ein Abzug der Fährkosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten war ebenfalls ausgeschlossen, da sie ausschließlich privat veranlasst waren.
| Information für: | Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Unterhält ein Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte, kann er seine Fahrtkosten zum Arbeitsort nur mit der Entfernungspauschale von 0,30 EUR (ab dem 21. Entfernungskilometer: 0,38 EUR) abziehen.
Hinweis: Laut Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung soll die Pendlerpauschale zum 01.01.2026 bereits ab dem 1. Entfernungskilometer von 30 Cent auf 38 Cent angehoben werden.
Die Pendlerpauschale gilt allerdings nach wie vor nur für die einfache Entfernung zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, so dass sich nur ein Weg pro Tag steuermindernd auswirkt. Für Fahrten zu anderen beruflichen Zielen, die keine erste Tätigkeitsstätte sind (z.B. zu Kunden), können Arbeitnehmer ihre Fahrten deutlich besser absetzen - und zwar nach Reisekostengrundsätzen mit 0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer (also Hin- und Rückweg). Zusätzlich lassen sich in diesem Fall noch Verpflegungspauschalen von bis zu 28 EUR und die tatsächlich angefallenen Übernachtungskosten absetzen.
Selbst an Homeoffice-Tagen müssen die Fahrtkosten für Auswärtstermine steuerlich nicht unter den Tisch fallen: Hat der Arbeitnehmer an solchen Tagen mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit im Homeoffice gearbeitet, erkennt das Finanzamt neben der Homeoffice-Tagespauschale von 6 EUR pro Tag zusätzlich auch die Fahrtkosten zu Auswärtsterminen nach Reisekostengrundsätzen an. Fahren Angestellte an ihrem Homeoffice-Tag aber in ihren Betrieb (erste Tätigkeitsstätte), erhalten sie für diesen Tag nur die Pendlerpauschale und nicht die Homeoffice-Tagespauschale.
Eine Ausnahme gilt jedoch für Berufstätige, die beim Arbeitgeber keinen Platz zum Arbeiten vorfinden, wie z.B. Lehrer oder Außendienstmitarbeiter ohne eigenes Büro. Sie dürfen die 6-EUR-Tagespauschale für maximal 210 Tage im Jahr ansetzen - selbst, wenn sie an den jeweiligen Tagen nur kurz zu Hause gearbeitet haben. Zusätzlich können sie die Pendlerpauschale für ihre Wege zur ersten Tätigkeitsstätte - und bei Auswärtseinsätzen ihre Reisekosten - absetzen.
| Information für: | Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Der Volksmund weiß: Bildung ist das beste Geschenk, das man sich selbst machen kann. Wenn Arbeitnehmer sich in ihrem Beruf fort- und weiterbilden, schenken sie sich nicht nur einen höheren Marktwert, sondern können die Kosten hierfür auch noch als Werbungskosten absetzen.
Im Steuerrecht gilt jede Bildungsmaßnahme, die nach einer abgeschlossenen Ausbildung absolviert wird, als Fort- oder Weiterbildung. Steht sie in einem klaren Zusammenhang mit der aktuellen oder künftig angestrebten beruflichen Position, erkennt das Finanzamt die Kosten an. Dabei ist es unerheblich, ob die Weiterbildung in Präsenz oder online stattfindet. Absetzbar sind bspw. Seminare, Fachtagungen und Kongresse, die vorhandene Fachkenntnisse erweitern - aber auch Umschulungen oder PC-Kurse, die auf eine neue berufliche Tätigkeit vorbereiten, sowie Meisterkurse, Masterstudiengänge oder Führungstrainings, die für eine höhere berufliche Position qualifizieren.
Hinweis: Sofern der Arbeitgeber oder die Agentur für Arbeit eine Fortbildungsmaßnahme finanziert, sind die Kosten nicht absetzbar, da der Arbeitnehmer in diesem Fall nicht wirtschaftlich belastet ist. Wird die Fortbildung jedoch nur zum Teil von dritter Seite erstattet, können zumindest die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.
Absetzbar sind Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Kosten für die Anfertigung einer Abschlussarbeit, Fachliteratur, Laptop, Software und Schreibmaterial. Für Lerntage zu Hause, z.B. zur Prüfungsvorbereitung, kann die Tagespauschale für das Homeoffice von 6 EUR angesetzt werden, sofern die Bildungseinrichtung an diesen Tagen nicht aufgesucht wurde.
Wird die Fortbildung auswärts absolviert, dürfen zusätzlich Reisekosten abgesetzt werden. Hierzu zählen neben den Fahrtkosten, die für Fahrten mit dem Pkw mit der Kilometerpauschale von 0,30 EUR und für Fahrten mit Bahn, Bus und Taxi mit den tatsächlichen Kosten angesetzt werden können, auch Parkgebühren, Verpflegungspauschalen und Übernachtungskosten.
Hinweis: Wer sich beruflich fortbildet, sollte alle Rechnungen, Quittungen und Kassenbelege zu den Bildungsmaßnahmen für die eigene Steuererklärung sammeln. Termine und Fahrten sollten unbedingt notiert werden, damit die Daten später schnell zur Hand sind. Eine Obergrenze für absetzbare Fortbildungskosten gibt es übrigens nicht.
| Information für: | Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wenn Sie Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit erzielen, können Sie die Kosten, die im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit anfallen, als Werbungskosten berücksichtigen. Arbeitet man nicht die gesamte Zeit im Homeoffice, können also auch Kosten für Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Um die Höhe der berücksichtigungsfähigen Kosten genau ermitteln zu können, ist es wichtig zu wissen, ob und wo man eine erste Tätigkeitsstätte hat. Im Streitfall ging es um einen Berufssoldaten. Das Finanzgericht Hessen (FG) musste entscheiden, wo dessen erste Tätigkeitsstätte ist.
Der Kläger war zunächst Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Er absolvierte die Offiziersausbildung verbunden mit einem entsprechenden Studium. Aufgrund einer Versetzungsverfügung wurde er von seinem bisherigen Dienstort zu einem Ausbildungszentrum der Bundeswehr versetzt. Er wurde zum Berufssoldaten ernannt und zum Leutnant befördert. Parallel dazu wurde ihm mit dem Dienstortwechsel ein anderer Dienstposten an dem bisherigen Dienstort zugewiesen. Der Kläger machte Fahrtkosten nach Dienstreisegrundsätzen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte aber nur die Entfernungspauschale.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Der Kläger war der Dienststelle der Bundeswehr zugeordnet. Das ergibt sich aus der Verfügung zum Dienstpostenwechsel. Er wurde zum Berufssoldaten ernannt und dann nach abgeschlossener Ausbildung und Studium entsprechend dem ihm zugewiesenen Rang dienstlich eingesetzt. Der Dienstherr hatte klargestellt, an welcher Dienststelle dies geschehen sollte. Diese Zuordnung war entgegen der Ansicht des Klägers dauerhaft, da er unbefristet der Dienststelle zugeordnet wurde. Das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten ist grundsätzlich unbefristet und endet erst durch Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand. Daher ist ab der Ernennung des Klägers zum Berufssoldaten eine Zuordnung zu einer Dienststätte maßgeblich.
Hinweis: Die Revision wurde nicht zugelassen, jedoch ist eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof anhängig.
| Information für: | Arbeitgeber und Arbeitnehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Informationen für Hausbesitzer
- Grundstücksübertragung: Veräußerungsgeschäft oder gemischte Schenkung?
- Privates Veräußerungsgeschäft: Grundstücksübertragung mit Schuldübernahme ist teilweise steuerpflichtig
- Urteil zum Grundstücksverkauf: Wann wird privat zu steuerpflichtig - und für wen?
Es gibt Lebenssachverhalte, die für das Steuerrecht schwer zu erfassen sind und sich für die Beteiligten oft unterschiedlich darstellen. Ein häufiger Streitpunkt zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigem ist die Frage, wie eine Tätigkeit einzuordnen ist. Aber auch die Beurteilung, ob es sich bei einem Vorgang um ein Veräußerungsgeschäft oder eine gemischte Schenkung handelt, kann im Einzelfall zu Problemen führen. Im Streitfall ging die Klägerin von einer gemischten Schenkung und das Finanzamt von einem Veräußerungsgeschäft aus. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste darüber urteilen.
Die Klägerin war zu 50 % Erbin ihres verstorbenen Vaters. Die anderen 50 % erbte ihre Mutter. Das Vermögen bestand nur aus Kapitalvermögen. Beide Erbinnen vereinbarten, das geerbte Kapitalvermögen langfristig anzulegen bzw. nicht kurzfristig aufzulösen und dass das Erbe durch Ratenzahlungen seitens der Mutter an die Klägerin ausgeglichen wird. Im Jahr 2014 erwarb die Klägerin von ihrer Mutter ein bebautes Grundstück zu einem Verkehrswert von 52.000 EUR.
Im Jahr 2016 veräußerte sie es für 160.000 EUR weiter (Zufluss in 2017). Die Klägerin erklärte in der Einkommensteuererklärung Vermietungseinkünfte. Sie war der Ansicht, es handele sich bei der Grundstücksübertragung um einen erbrechtlichen Vorgang mit Versorgungscharakter bzw. eine gemischte Schenkung. Das Finanzamt sah darin jedoch ein privates Veräußerungsgeschäft.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Das Finanzamt ging zutreffend von einem privaten Veräußerungsgeschäft aus und hatte dieses dementsprechend der Besteuerung unterworfen. Die Klägerin hatte das Grundstück nach dem Erwerb in 2014 innerhalb von weniger als zehn Jahren veräußert. Entgegen ihrer Ansicht lag kein erbrechtlicher Vorgang mit Versorgungscharakter vor. Hierfür gab es nach Ansicht des Gerichts keine Anhaltspunkte. Auch lag keine gemischte Schenkung vor, da sich dafür die Beteiligten einig sein müssen, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Die Klägerin hatte das Grundstück in Höhe des Marktwerts erworben.
Das FG konnte aber nicht feststellen, dass die Klägerin und ihre Mutter um den tatsächlichen Wert des übertragenen Grundstücks wussten und sich hinsichtlich der Wertdifferenz darüber einig waren, dass die Mutter ihrer Tochter das Grundstück teilweise unentgeltlich zuwendet.
| Information für: | Hausbesitzer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wer Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft, muss den erzielten Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuern (bei Selbstnutzung gibt es Ausnahmen). Als steuerauslösender Verkauf gilt aber nur die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts, nicht jedoch eine Schenkung. Steuerliche Fallstricke lauern jedoch, wenn ein Grundstück zwar ohne Kaufpreisfestlegung übertragen wird, der Erwerber jedoch die darauf lastenden Schulden übernimmt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass die Grundstücksübertragung in diesem Fall aufgrund der Schuldübernahme teilentgeltlich ist und daher anteilig ein privater Spekulationsgewinn versteuert werden muss. Geklagt hatte ein Vater, der im Jahr 2014 ein Grundstück für 143.950 EUR erworben und teilweise fremdfinanziert hatte. Fünf Jahre später hatte er das Grundstück auf seine Tochter übertragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Grundstück einen Wert von 210.000 EUR. Die Tochter hatte im Rahmen der Übertragung die noch bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 115.000 EUR übernommen.
Das Finanzamt teilte den Vorgang in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf - ausgehend vom Verkehrswert im Übertragungszeitpunkt. Soweit das Grundstück unter Übernahme der Verbindlichkeiten entgeltlich übertragen worden war, besteuerte es den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft und setzte Spekulationssteuer (Einkommensteuer) gegenüber dem Vater fest.
Der BFH bestätigte diese Berechnung nun und erklärte, dass regelmäßig ein teilentgeltlicher Vorgang vorliege, wenn ein Wirtschaftsgut übertragen wird und zugleich damit zusammenhängende Verbindlichkeiten vom Erwerber übernommen werden. Wird das Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen, unterfällt der Vorgang hinsichtlich des entgeltlichen Teils als privates Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer.
Hinweis: Bei der Übertragung von Immobiliarvermögen an die nächste Generation sollte daher unbedingt die zehnjährige Spekulationsfrist im Auge behalten werden - auch wenn für die Übertragung kein Kaufpreis, sondern nur eine Schuldübernahme festgelegt wurde.
| Information für: | Hausbesitzer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
In einem aktuellen Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) wichtige Klarstellungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Verkaufs von ursprünglich privat gehaltenen Grundstücken durch Ehegatten getroffen. Im Mittelpunkt standen dabei zwei zentrale Fragen: Wann liegt eine wirtschaftliche Tätigkeit vor? Und wer ist in einem solchen Fall als steuerpflichtig anzusehen: die Ehegatten jeweils einzeln oder gemeinsam?
Die Eheleute im Besprechungsfall lebten in gesetzlicher Gütergemeinschaft in Polen und erhielten im Jahr 1989 von den Eltern der Ehefrau unentgeltlich landwirtschaftliche Grundstücke. 2011 beschlossen sie deren Verkauf und beauftragten dafür einen Geschäftsbesorger. Dieser übernahm unter anderem die Parzellierung, Umwidmung in Bauland, Erschließung, den Erwerb eines Zufahrtsgrundstücks sowie die Vermarktung.
Seine erfolgsabhängige Vergütung entsprach der Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten und dem tatsächlich erzielten Verkaufspreis. Zwischen 2017 und 2021 wurden die Grundstücke verkauft. Die polnische Steuerverwaltung sah in diesen Verkäufen eine wirtschaftliche Tätigkeit und unterwarf beide Ehegatten einzeln der Mehrwertsteuer.
Der EuGH entschied, dass eine ursprünglich zum Privatvermögen gehörende Fläche dann steuerlich relevant wird, wenn aktive Vermarktungsmaßnahmen ergriffen werden, wie sie typischerweise von Händlern oder Dienstleistern ausgeübt werden. Dazu zählen insbesondere: Umwidmung von Nutzungsarten, Erschließung, Werbung und aktive Verkaufsorganisation. Diese Maßnahmen gehen laut EuGH über eine bloße Verwaltung von Privatvermögen hinaus und stellen eine wirtschaftliche Tätigkeit dar. Dass ein Geschäftsbesorger eingeschaltet worden sei, ändere daran nichts, denn das wirtschaftliche Risiko sei letztlich bei den Eheleuten verblieben.
Der EuGH betonte, dass die Bestimmung des Steuerpflichtigen dem nationalen Recht obliegt. Im konkreten Fall kann die Ehegattengemeinschaft als Steuerpflichtiger angesehen werden, sofern sie als wirtschaftlich Handelnde auftritt und das unternehmerische Risiko trägt. Nationale Regelungen können auch nichtrechtsfähige Gemeinschaften als eigenständige Unternehmer anerkennen.
Hinweis: Ob der Verkauf von Grundstücken durch Ehegatten der Umsatzsteuer unterliegt, hängt maßgeblich von der Art der Vermarktung ab. Ehegatten sollten prüfen lassen, ob sie einzeln oder gemeinsam als Unternehmer gelten. In Deutschland ist diese Frage weiterhin umstritten.
| Information für: | Hausbesitzer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Informationen für Kapitalanleger
- Börsengehandelte Indexfonds: Besteuerungsregeln von ETFs im Überblick
Sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich unter Anlegern seit Jahren großer Beliebtheit. Sie sind eine transparente, flexible und unkomplizierte Form der Geldanlage, um von Kursgewinnen an der Börse zu profitieren.
Die Besteuerung von ETFs ist mittlerweile recht unkompliziert: Die Besteuerung übernehmen die depotführenden Banken, sofern sie in Deutschland ansässig sind. Sie führen die sog. Vorabpauschale und die Abgeltungsteuer selbständig an das Finanzamt ab. In diesem Fall müssen Steuerzahler nichts weiter unternehmen. Die bereits versteuerten Kapitalerträge müssen nicht mehr in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.
Steigt der Wert eines ETFs, werden beim Verkauf Steuern fällig. Der Gewinn wird mit der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % belastet; hinzu kommen der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % der Abgeltungsteuer und gegebenenfalls die Kirchensteuer mit 8 oder 9 % der Abgeltungsteuer - je nach Bundesland. Die Steuerlast liegt somit zwischen 26,38 bis 28 %. Ausschüttende Fonds, die Gewinne sofort auszahlen, werden bei der Auszahlung auf die gleiche Weise besteuert.
Hinweis: In vielen Fällen kommen die Abzugsteuern erst gar nicht zum Tragen, denn der Sparerpauschbetrag von 1.000 EUR pro Person und Jahr belässt Kapitalgewinne bis zu dieser Höhe steuerfrei. Der automatische Steuereinbehalt durch die Bank kann aber nur verhindert werden, wenn bei der depotführenden Bank ein Freistellungsauftrag eingerichtet wurde.
Die Besteuerung von Aktien-ETFs erfolgt nur ausschnittsweise, denn je nach Art des Fonds wird ein bestimmter Prozentsatz des Gewinns nicht besteuert. Bei ETFs mit einem Aktienanteil von mehr als 51 % bleiben 30 % des Gewinns steuerfrei. Bei Mischfonds mit einem Aktienanteil von mindestens 25 % werden 15 % des Gewinns nicht besteuert. Bei Immobilienfonds mit mehr als der Hälfte Immobilien sind 60 % des Gewinns steuerfrei, bei Auslandsimmobilien-Fonds sogar 80 %. Ist der Aktien- oder Immobilienanteil geringer, gibt es keine Gewinnfreistellung. Für Anleihen-ETFs oder Rohstoff-ETFs gibt es keine Teilfreistellung.
Bei thesaurierenden Fonds wird der Gewinn einbehalten und direkt wieder angelegt. Damit die Besteuerung nicht ewig in die Zukunft verschoben wird, werden alljährlich Vorabsteuern erhoben. Wird der Fonds eines Tages - unter Umständen nach jahrzehntelanger Haltedauer - verkauft, ist ein Teil der Wertsteigerung bereits versteuert worden. Zum Verkaufszeitpunkt werden von der Abgeltungssteuer dann die entrichteten Vorabpauschalen abgezogen und nur die Differenz wird besteuert. Somit sind ausschüttende und thesaurierende ETFs am Ende steuerlich gleichgestellt.
| Information für: | Kapitalanleger |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Informationen für Unternehmer
- Ausländische Anteilseignergesellschaften: Zu erstattende Kapitalertragsteuerbeträge sind zu verzinsen
- ihnen die Erstattung der Steuerbeträge unter Verstoß gegen das Unionsrecht vorenthalten wird oder
- die Kapitalertragsteuer von vornherein unter Verstoß gegen das Unionsrecht einbehalten wird.
- Betriebsausgaben: Kleinflugzeug als "Firmenwagen"?
- Bilanzierungsregeln: Aktivierungsverbot einer später bestrittenen Schuld
- Bürokratieentlastung im Außenhandel: Rückwirkende Anhebung der Intrahandelsstatistik-Anmeldeschwellen
- Für Versendungen (Exporte in andere EU-Mitgliedstaaten): Die Meldepflicht gilt erst, wenn der Warenwert im laufenden oder im vorangegangenen Kalenderjahr 1 Mio. EUR überschreitet (bisher: 500.000 EUR).
- Für Eingänge (Importe aus anderen EU-Mitgliedstaaten): Die Meldepflicht greift erst, wenn der Warenwert 3 Mio. EUR überschreitet (bisher: 800.000 EUR).
- Einzelfallprinzip statt pauschaler Sanktion: EuGH nimmt die Folgen von Verstößen ins Visier
- Verhältnismäßigkeit: Eine Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister darf nicht automatisch erfolgen. Erforderlich ist eine Einzelfallprüfung, die die Art und Schwere des Verstoßes sowie mögliche mildere Maßnahmen berücksichtigt.
- Rechtssicherheit: Steuerpflichtige müssen die Konsequenzen ihres Verhaltens eindeutig erkennen können. Sanktionen, die ohne umfassende Prüfung des Sachverhalts zur Beendigung der Registrierung führen, sind mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht vereinbar.
- Unionsrechtskonformität der nationalen Regelungen: Nationale Vorschriften, die formale Verstöße ohne individuelle Prüfung sanktionieren, verstoßen gegen die MwStSystRL.
- Entlastung für Gastronomen: Dauerhafte Mehrwertsteuersenkung auf Speisen
- Ermäßigter Steuersatz auf Speisen: Ab dem 01.01.2026 unterliegen Speisen in gastronomischen Betrieben dauerhaft dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Diese Regelung gilt sowohl für den Verzehr vor Ort als auch für die Mitnahme.
- Abgrenzung Speisen vs. Getränke: Der ermäßigte Steuersatz gilt ausschließlich für Speisen. Getränke unterliegen grundsätzlich dem Regelsteuersatz von 19 %. Eine wichtige Ausnahme bilden hier weiterhin Milchmischgetränke mit einem Milchanteil von mindestens 75 %, die wie auch schon bisher mit 7 % besteuert werden.
- Technische Umsetzungspflichten: Gastronomiebetriebe müssen sicherstellen, dass ihre Kassensysteme zum 01.01.2026 korrekt programmiert sind, um die neue Steuersatzregelung umzusetzen.
- Anzahlungen und Leistungszeitpunkt: Gerade für Caterer ist relevant, dass bei Anzahlungen die Umsatzsteuer mit der Vereinnahmung des Entgelts zu dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Steuersatz entsteht. Gilt im Zeitpunkt der Leistungserbringung ein anderer Steuersatz, ist dieser zu korrigieren. Das Bundesfinanzministerium (BMF) wird hierzu voraussichtlich noch Vereinfachungsregelungen erlassen.
- Sonderfall Silvesternacht: Umsätze unmittelbar zum Jahreswechsel 2025/2026 können hinsichtlich des genauen Leistungszeitpunkts schwierig einzuordnen sein. Auch hier wird eine Klarstellung durch das BMF erwartet.
- Gutscheine und Umsatzsteuer: Bei vor dem 01.01.2026 verkauften Restaurantgutscheinen, die erst danach eingelöst werden, ist zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen zu unterscheiden. Einzweckgutscheine werden bereits zum Verkaufszeitpunkt versteuert, somit also noch mit dem bis Ende 2025 gültigen Steuersatz. Mehrzweckgutscheine werden erst bei Einlösung versteuert. Erfolgt diese erst im neuen Jahr, dann greift bereits der ermäßigte Satz von 7 %.
- Ergebnislose Außenprüfung: Mitteilung des Finanzamts ist kein anfechtbarer Verwaltungsakt
- Fleischwirtschaft: Fremdpersonalverbot kann nicht prognostisch gerichtlich überprüft werden
- Keine Umsatzsteuerbefreiung: Reitunterricht dient in der Regel der Freizeitgestaltung
- Milliardenbetrug in der Bargeldbranche: Bundesrechnungshof fordert häufigere Kassen-Nachschauen
- Statistisches Bundesamt: Mehr Betriebsgründungen, mehr Regelinsolvenzen
- Steueranrechnungsmethode: Nationaler Switch-over setzt Beherrschung der Auslandsgesellschaft voraus
- Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit: Petitions-Plattform kann das demokratische Staatswesen fördern
- Umsatzsteuer bei IT-Dienstleistungen: Finanzgericht stärkt Unternehmen bei Projektmitwirkung
- Umsatzsteuer bei digitalen Leistungen: Klärung zur Rolle von App Stores und Leistungsort
- Ist der App Store bei Umsätzen vor 2015 als leistender Unternehmer anzusehen, auch wenn die App-Entwicklerin als Verkäuferin genannt wird und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen ist?
- Welcher Ort ist für die Umsatzsteuer maßgeblich? Der Sitz des App Stores oder der Wohnort des Endkunden?
- Führt der Ausweis deutscher Umsatzsteuer in Bestellbestätigungen an Endkunden zu einer Steuerpflicht der App-Entwicklerin?
- Verfahren zu Verlustausgleichszahlungen: Subventionen im öffentlichen Personennahverkehr
- Verschonungsregelung: Begünstigtes Betriebsvermögen
- Wegweisende Schlussanträge: Mehr Klarheit bei Konzernverrechnungen
Gute Nachrichten für ausländische Anteilseignergesellschaften: Ist ihnen die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen (nach Art. 5 der Mutter-Tochter-Richtlinie i.V.m. § 50d Abs. 1 S. 2 des Einkommensteuergesetzes a.F.; heute § 50c Abs. 3 S. 1 EStG) zu erstatten, haben sie nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) einen Verzinsungsanspruch auf der Grundlage des Unionsrechts, wenn
Die Entscheidung hat eine beträchtliche finanzielle Tragweite für den Fiskus, denn in der Vergangenheit hatte das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vielen ausländischen Anteilseignern die Erstattung von Kapitalertragsteuer verweigert. Dies verstieß nach den Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Deister Holding und Juhler Holding vom 20.12.2017 (C 504/16 und C 613/16) jedoch gegen das Unionsrecht. In all diesen Fällen kann es nunmehr zur Festsetzung von Zinsen kommen.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine deutsche Aktiengesellschaft (AG) Gewinnausschüttungen an eine österreichische Muttergesellschaft vorgenommen. Für drei der Gewinnausschüttungen wurde die Erstattung der von der AG einbehaltenen Kapitalertragsteuer im Erstattungsverfahren vom BZSt unter Verstoß gegen das Unionsrecht abgelehnt. Für eine weitere Gewinnausschüttung war der österreichischen Muttergesellschaft zunächst eine sogenannte Freistellungsbescheinigung erteilt worden, nach der die AG keine Kapitalertragsteuer hätte einbehalten müssen. Diese Freistellungsbescheinigung wurde vom BZSt in unionsrechtswidriger Weise widerrufen.
Das BZSt hatte nach Ergehen der EuGH-Entscheidung Deister Holding und Juhler Holding die Kapitalertragsteuer im Rahmen der zeitweise ruhenden Einspruchsverfahren erstattet. Die allein streitgegenständlichen Verzinsungsanträge der österreichischen Muttergesellschaft hatte es abgelehnt. Das Argument: Eine Verzinsung für erstattete Kapitalertragsteuerbeträge sei nicht zu gewähren, wenn die Steuer unter Abhilfe eines Einspruchs erstattet werde. Das Finanzgericht gab der Klage hingegen teilweise statt.
Der BFH entschied, dass der österreichischen Muttergesellschaft eine Verzinsung nach dem unionsrechtlichen Zinsanspruch zusteht. Der Zinslauf beginnt in Fällen, in denen ohne ein vorheriges Freistellungsbescheinigungsverfahren die Erstattung der Kapitalertragsteuer beantragt und im Erstattungsverfahren in unionsrechtswidriger Weise vorenthalten werde, drei Monate nach der Einreichung eines formal ordnungsgemäßen Erstattungsantrags.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wenn man als Geschäftsführer häufig unterwegs ist, macht es durchaus Sinn, einen Firmenwagen zu haben. Sind jedoch weite Strecken zurückzulegen, ist oftmals ein Flug die schnellste Option. So wie man ein Auto für sein Unternehmen erwerben kann, geht das natürlich auch mit einem Flugzeug. Aber ist das noch wirtschaftlich und angemessen? Muss das Finanzamt die Kosten akzeptieren? Das Finanzgericht Münster musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die Klägerin, eine GmbH, erwarb im Jahr 2017 ein Kleinflugzeug, welches überwiegend vom Alleingesellschafter-Geschäftsführer genutzt wurde. Da dieser keinen Flugschein besaß, wurden immer betriebsfremde Piloten engagiert und die Kosten als Betriebsausgaben geltend gemacht. Bei einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, die Ausgaben könnten, soweit sie als unangemessen anzusehen seien, nicht berücksichtigt werden. Nur Kosten in Höhe der Entfernungspauschale, ein Stundenlohn von 10 EUR für einen Chauffeur und geschätzte Hotelkosten könnten berücksichtigt werden. Den darüber hinausgehenden Aufwand schloss die Betriebsprüfung vom Betriebsausgabenabzug aus.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Nach Ansicht des Gerichts waren die Aufwendungen für das Kleinflugzeug nach allgemeiner Verkehrsauffassung nicht unangemessen. Die private Lebensführung des Gesellschafter-Geschäftsführers werde allenfalls nur in sehr eingeschränktem Maße berührt. Zudem habe das Flugzeug auch anderen Betriebsangehörigen zur Verfügung gestanden. Des Weiteren sei es in einem späteren Veranlagungszeitraum nach der Verlegung des Firmensitzes an einen verkehrsgünstigeren Ort veräußert worden. Zwar seien die Aufwendungen für das Flugzeug nicht unerheblich gewesen, jedoch habe die Klägerin einen positiven Beitrag des Flugzeugs für ihren Geschäftserfolg darlegen können.
Die Ansicht des Finanzamts, dass im Rahmen der Angemessenheitsprüfung unter anderem ein Vergleich der Flugzeugkosten mit den Kosten für die Einstellung eines weiteren Geschäftsführers im Umfang der ersparten Zeit relevant sei, treffe nicht zu. Da der Geschäftsführer Namensgeber und Gründer der Klägerin gewesen, der Geschäftserfolg also eng mit seiner Person verbunden sei, könne eine Investition in seine Reisetätigkeiten "lohnender" sein als die Anstellung eines zweiten Geschäftsführers.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Körperschaftsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Bei der Erstellung der Bilanz Ihres Unternehmens müssen Sie Forderungen aktivieren. In der Regel geschieht das im Umlaufvermögen, da die Forderungen meist zeitnah eingezogen werden. Beispiele hierfür sind Kundenforderungen oder kurzfristige Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Oftmals machen diese Forderungen einen großen Posten im Umlaufvermögen aus. Allerdings können und dürfen nicht alle Forderungen in der Bilanz aktiviert werden. Es gilt nämlich auch das Vorsichtsprinzip, wonach Forderungen, die zum Beispiel bestritten wurden, nicht aktiviert werden dürfen. Im Streitfall musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden, ob ein Ansatz vorzunehmen war oder nicht.
Die Klägerin betrieb eine Unternehmensberatung. Der Gewinn hieraus wurde durch Bestandsvergleich ermittelt. Es wurde eine Bilanz erstellt. Diese Bilanz enthielt Forderungen gegenüber der Firma E aus Beratungsleistungen. Diese wurden in voller Höhe wertberichtigt. Das Finanzamt erkannte dies allerdings nicht an, weil weder ein Mahnverfahren noch Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet wurden.
Die Klage vor dem FG war jedoch erfolgreich. Die Wertberichtigung war zulässig. In einem Schreiben des Rechtsanwalts der E wurden die Beratungsleistungen insgesamt bestritten, was im vorliegenden Fall entscheidend war. Grundsätzlich sind Forderungen eines Dienstleisters auf Bezahlung in dem Zeitpunkt zu aktivieren, in dem dieser seine Dienstleistung vertragsgemäß erbracht hat. Auf Rechnungsstellung oder Fälligkeit kommt es nicht an. Die Klägerin durfte aufgrund des vollständigen Bestreitens durch die E im November 2014 die offenen Forderungen in der Steuerbilanz zum Bilanzstichtag 31.12.2014 nicht (mehr) aktivieren.
Es bestand insoweit kein Aktivierungswahlrecht, sondern sowohl für die Handels- als auch für die Steuerbilanz ein Aktivierungsverbot. Daher wurden die einzelnen Forderungen durch eine Teilwertabschreibung auf null ausgebucht. Auch etwaige Erfolgsaussichten eines Gerichtsprozesses sind nicht von Bedeutung. Die Forderung kann nicht - auch nicht teilweise - aktiviert werden, weil durch das Schreiben des Anwalts der E die Ansprüche ernsthaft bestritten wurden.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Mit dem Außenhandelsstatistikänderungsgesetz (AHStatG-ÄndG) vom 27.02.2025 sowie der Änderungsverordnung zur Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung (AHStatDV-ÄndV) vom 06.03.2025 wurden im Bereich der Außenhandelsstatistik wesentliche Entlastungen für Unternehmen eingeführt. Ziel ist es, die bürokratischen Belastungen durch die Meldung von Warenbewegungen innerhalb der EU zu reduzieren und die Verwaltung zu vereinfachen. Rückwirkend zum 01.01.2025 wurden die Anmeldeschwellen zur Intrahandelsstatistik (Intrastat) deutlich angehoben:
Überschreitet ein Unternehmen im laufenden Kalenderjahr eine dieser Schwellen, besteht ab dem Monat der Überschreitung eine Meldepflicht für die jeweilige Verkehrsrichtung. Unternehmen, die die neuen Schwellenwerte weder im Jahr 2024 noch bisher im Jahr 2025 überschritten haben, sind ab sofort von der Pflicht zur Abgabe der Intrastat-Anmeldungen befreit. Die Meldungen müssen erst bei Überschreiten der neuen Schwellenwerte wieder aufgenommen werden. Eine freiwillige weitere Meldung ist weiterhin möglich.
Durch die Anhebung der Schwellenwerte sinkt die Zahl der meldepflichtigen Unternehmen deutlich. Viele mittelgroße Firmen sind nun von der Meldepflicht befreit, was die Bürokratie erheblich reduziert. Auch die Bagatellgrenzen wurden erhöht, so dass vereinfachte Anmeldungen von Warenzusammenstellungen möglich sind. Es können sowohl genehmigungspflichtige als auch genehmigungsfreie Erleichterungen genutzt werden.
Das Änderungsgesetz schafft zudem Klarheit zu Meldepflichten, etwa zur Korrektur fehlerhafter Meldungen und zur Anmeldung von Teilsendungen. Ein aktualisierter Leitfaden zur Intrastat erklärt diese Neuerungen. Bereits abgegebene Intrastat-Meldungen für Januar 2025 bleiben gültig und müssen nicht neu eingereicht, aber bei Bedarf korrigiert werden.
Hinweis: Während in Deutschland die Schwellenwerte deutlich angehoben wurden, können sie sich in anderen EU-Ländern abweichend entwickeln. Unternehmen sollten daher die jeweiligen nationalen Vorschriften prüfen, um ihre Meldepflichten zu erfüllen.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wie weit dürfen Steuerbehörden bei formalen Verstößen gehen? Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit einer aktuellen Entscheidung wichtige Maßstäbe für den Umgang mit Pflichtverletzungen im Mehrwertsteuerrecht gesetzt. Eine automatische Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister allein aufgrund formaler Versäumnisse verstößt demnach gegen die unionsrechtlichen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Rechtssicherheit.
Im Besprechungsfall wurde ein bulgarisches Bauunternehmen nach einer Steuerprüfung im Jahr 2022 von der nationalen Steuerbehörde aus dem Mehrwertsteuerregister gestrichen. Grundlage waren mehrere Verstöße gegen steuerliche Pflichten. So hatte das Unternehmen im Zeitraum von 2013 bis 2018 wiederholt erklärte und geschuldete Mehrwertsteuer nicht gezahlt. Zum Teil resultierten diese Verstöße aus Streitigkeiten mit Geschäftspartnern, was das Unternehmen auch in einem Berufungsverfahren vorbrachte. Die Steuerbehörde hielt aber an der Streichung fest.
Das zuständige bulgarische Verwaltungsgericht legte daraufhin dem EuGH Fragen zur Auslegung der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) vor - insbesondere dahin gehend, ob nationale Regelungen, die eine Streichung ohne Prüfung der Umstände des Einzelfalls erlauben, mit dem Unionsrecht vereinbar sind.
Der EuGH stellte klar, dass Mitgliedstaaten zwar befugt sind, Maßnahmen zur Sicherstellung der Steuererhebung und Steuerbetrugsbekämpfung zu ergreifen. Diese Maßnahmen müssen jedoch mit den grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts in Einklang stehen:
Hinweis: Die Entscheidung stärkt die Rechte von Unternehmern gegen unverhältnismäßige Maßnahmen nationaler Steuerverwaltungen. Künftig müssen Behörden im Binnenmarkt Pflichtverletzungen individuell prüfen. Pauschale Sanktionen sind unzulässig.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Im Koalitionsvertrag wurde eine zentrale steuerpolitische Entscheidung für die Gastronomiebranche getroffen: Ab dem 01.01.2026 gilt dauerhaft der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % auf Speisen in der Gastronomie. Damit wird eine während der Corona-Pandemie eingeführte Maßnahme nun fest ins Umsatzsteuerrecht übernommen. Im Einzelnen gelten die folgenden steuerlichen Regelungen:
Hinweis: Die dauerhafte Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Speisen ab 2026 stellt eine klare Entlastung für gastronomische Betriebe dar. Die Umsetzung erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung in der Kassenführung, Vertragsgestaltung und steuerlichen Abwicklung. Weitere Verwaltungshinweise durch das BMF werden erwartet und sind für eine rechtssichere Umsetzung essentiell.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Das Leben hält bekanntlich viele Prüfungen bereit - für Unternehmer kommen zusätzlich noch Betriebsprüfungen des Finanzamts hinzu. Die Erleichterung ist daher groß, wenn letztere Prüfung zu keiner Änderung führt - man spricht dann im Verwaltungsjargon von einer ergebnislosen Außenprüfung. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass die Mitteilung über eine ergebnislose Außenprüfung kein anfechtbarer Verwaltungsakt ist.
Hinweis: Ein Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
Mitteilungen über eine ergebnislose Außenprüfung fallen nach Auffassung des BFH nicht unter diese Definition, da ihnen lediglich eine Dokumentations- und Protokollfunktion zukommt - sie geben nur Auskunft über das tatsächliche Ergebnis der durchgeführten Außenprüfung. Diese Einordnung verstößt nicht gegen das verfassungsrechtliche Gebot effektiven Rechtsschutzes.
Hinweis: Beantragt der geprüfte Steuerzahler während der Außenprüfung, einen Verwaltungsakt zu erlassen oder einen bereits ergangenen Verwaltungsakt aufzuheben oder zu ändern, und kommt die Außenprüfung stattdessen zu dem Ergebnis, dass die Besteuerungsgrundlagen nicht zu ändern sind, so beseitigt dies nicht die Verpflichtung der Finanzbehörde, über den Antrag des Steuerzahlers zu entscheiden.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Im Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) ist geregelt, dass Betriebsinhaber im Bereich der Schlachtung einschließlich der Zerlegung von Schlachtkörpern sowie im Bereich der Fleischverarbeitung nur Arbeitnehmer im Rahmen von eigenen Arbeitsverhältnissen beschäftigen dürfen. Hier können demnach keine Selbständigen mehr tätig werden; auch Dritte dürfen keine Arbeitnehmer mehr zur Verfügung stellen, keine Selbständigen mehr einsetzen und keine Leiharbeitnehmer mehr überlassen.
Für Unternehmen im Bereich der Fleischwirtschaft ist mitunter schwer zu beurteilen, ob sie aufgrund ihrer jeweiligen Betriebsabläufe dem Fremdpersonalverbot unterfallen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass ein Wurstproduzent nicht jederzeit gerichtlich klären lassen kann, ob er dem Fremdpersonalverbot nach dem GSA Fleisch unterliegt.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Wurstproduzentin die gerichtliche Feststellung beantragt, dass sie an einem bestimmten Standort keinen Betrieb und keine selbstständige Betriebsabteilung der Fleischwirtschaft unterhält und deshalb nicht dem Fremdpersonalverbot unterliegt. Hilfsweise hatte sie die Feststellung beantragt, dass bestimmte Betriebsbereiche an diesem Standort nicht dem Bereich der Fleischverarbeitung unterfielen. Die Besonderheit in diesem Fall lag darin, dass die Wurstproduzentin noch überhaupt nicht mit einer Prüfungsmaßnahme des zuständigen Hauptzollamts (HZA) zu dieser Frage konfrontiert war.
Der BFH hielt die Klage für unzulässig und erklärte, dass die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts nur begehrt werden könne, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung habe (Feststellungsklage). Vorliegend fehlte es bereits an einem hinreichend konkretisierten Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der Behörde. Denn das HZA hatte keine konkreten Prüfungsmaßnahmen durchgeführt oder angeordnet, die darauf abzielten, die Anwendung des Fremdpersonalverbots bei der Wurstproduzentin zu prüfen.
Die Klägerin war daher lediglich "potentielle Adressatin" einer abstrakt-generellen Norm. Zudem fehlte es an dem für eine Feststellungsklage erforderlichen berechtigten Interesse an der baldigen Feststellung. Denn die Klägerin hatte lediglich eine rechtsgutachterliche Prüfung angestrebt, nicht dem Anwendungsbereich des Fremdpersonalverbots zu unterliegen.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Die Erteilung von Schul- und Hochschulunterricht ist nach dem Umsatzsteuergesetz in der Regel umsatzsteuerfrei. Immer wieder muss sich die Rechtsprechung in Grenzfällen mit der Frage auseinandersetzen, ob Unterrichtsleistungen unter diese Steuerbefreiung fallen oder aber der Freizeitgestaltung zuzurechnen sind. So auch in einem aktuellen Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem es um die Erteilung von Reitunterricht ging.
Im vorliegenden Fall wollte der Kläger die Steuerbefreiung für verschiedene Reitkurse in Anspruch nehmen, die er für Kinder und Jugendliche auf seinem Reiterhof durchgeführt hatte. In der sog. "Ponygruppe" waren Kinder und Jugendliche, bei Klassenfahrten ganze Schulklassen im Umgang mit Pferden unterrichtet worden. Zudem hatte er Kurse für eine "Große Pferdegruppe" angeboten, die auf das Ablegen von Leistungsabzeichen gerichtet waren. Die unterrichteten Kinder und Jugendlichen waren zudem von ihm verpflegt worden und hatten teilweise auch auf dem Reiterhof übernachtet. Das Finanzamt war der Auffassung, dass sämtliche Leistungen des Reiterhofs steuerpflichtig seien.
Der BFH urteilte, dass die Erteilung von Reitunterricht nur von der Umsatzsteuer befreit ist, wenn sie der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung dient. Bei der Beherbergung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen handelte es sich zunächst einmal um selbständige steuerpflichtige Leistungen neben dem Reitunterricht.
Reitunterricht (als spezialisierter Unterricht) ist kein Schul- und Hochschulunterricht. Entsprechendes ist bereits für Segel-, Fahr-, Schwimm-, Jagd- und Tanzschulen entschieden worden. Die Einstufung von Reitunterricht als steuerfreie Ausbildung oder Fortbildung kommt nur ausnahmsweise und unter strengen Voraussetzungen in Betracht. Reitunterricht, der typischerweise der Freizeitgestaltung dient, ist nach Auffassung des BFH in der Regel keine Ausbildung oder Fortbildung, da er nicht auf einen bestimmten Beruf vorbereitet.
Die Kurse der "Ponygruppe" und für Schulklassen im Rahmen der Klassenfahrten waren daher umsatzsteuerpflichtig. Die Kurse der "Großen Pferdegruppe" waren ausnahmsweise umsatzsteuerfrei, da zahlreiche Teilnehmer später Turniersportreiter wurden.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Durch Steuerbetrug in bargeldintensiven Branchen entgehen dem deutschen Fiskus jährlich schätzungsweise Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Der Bundesrechnungshof (BRH) hat nun kritisiert, dass angesichts von Betrugsquoten von bis zu 80 % viel zu selten staatliche Kontrollen stattfinden.
Hinweis: Über eine Kassen-Nachschau kann die Finanzverwaltung unangekündigt und spontan die Kassenaufzeichnungen und -buchungen direkt vor Ort in den Betrieben prüfen. Über dieses Kontrollinstrument sollten ursprünglich jährlich 2,4 % aller Betriebe überprüft werden - dies sind aber lediglich rund 190.000 Betriebe pro Jahr, so dass jeder Betrieb damit durchschnittlich nur alle 42 Jahre mit einer Kassen-Nachschau rechnen müsste.
Der BRH kritisiert, dass die Finanzverwaltung tatsächlich nur höchstens 15.000 Kassen-Nachschauen pro Jahr durchführt. Für unehrliche Steuerzahler besteht also kaum ein Risiko, entdeckt zu werden. Eine präventive Wirkung kann die Kassen-Nachschau aus Sicht des BRH daher nicht entfalten.
Dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist es nach Auffassung des BRH nicht gelungen, mit den Bundesländern überhaupt Ziele für die Zahl der Kassen-Nachschauen und Grundlagen einer einheitlichen Ausgestaltung zu vereinbaren. Es hat diese Bemühungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Der BRH erklärt, dass dies nicht hinnehmbar sei und das BMF die milliardenschweren Steuerausfälle in bargeldintensiven Branchen entschlossen eindämmen müsse.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Im 1. Quartal 2025 wurden in Deutschland rund 36.500 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren dies 11,4 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Quartal 2024. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 10 % auf rund 30.200.
Hinweis: Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung geht die Statistik aus, wenn ein Betrieb durch eine juristische Person oder eine Personengesellschaft gegründet oder aufgegeben wird. Auch von natürlichen Personen unterhaltene Betriebe können hierunter fallen, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.
Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen ist in Deutschland im April 2025 um 3,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Damit lag die Zuwachsrate wie bereits im März 2025 (+ 5,7 %) im einstelligen Bereich, nachdem zuvor von Juli 2024 bis Januar 2025 zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich verzeichnet worden waren.
Für den Februar 2025 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2.068 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Dies waren 15,9 % mehr als im Februar 2024. Die Forderungen der Gläubiger aus den im Februar 2025 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 9 Mrd. EUR. Im Februar 2024 hatten die Forderungen bei rund 4,1 Mrd. EUR gelegen.
Die meisten Insolvenzen je 10.000 Unternehmen entfielen auf den Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 10 Fällen. Danach folgten die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (z.B. Zeitarbeitsfirmen) mit 9,3 Fällen sowie das Gastgewerbe mit 9 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in einem neuen Urteil zu einer praxisrelevanten Frage des internationalen Steuerrechts positioniert und entschieden, dass der sogenannte nationale Switch-over zur Steueranrechnungsmethode die Beherrschung der Auslandsgesellschaft voraussetzt.
Geklagt hatte eine deutsche Kapitalgesellschaft, die zu 30 % (und damit nicht mehrheitlich) an einer in den USA ansässigen Personengesellschaft beteiligt war. Diese Gesellschaft erzielte Gewinne aus der internationalen Vergabe von Lizenzen. Die Gewinne wurden der Klägerin im Umfang ihrer Gesellschaftsbeteiligung zugerechnet; in den USA zahlte sie hierauf nur geringe Steuern. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und Deutschland sah vor, dass Gewinne aus ausländischen Betriebsstätten in Deutschland von der Steuer freizustellen waren.
Die geringe steuerliche Belastung in den USA nahm das Finanzamt (FA) aber zum Anlass, die Auslandsgewinne doch der deutschen Körperschaftsteuer zu unterwerfen und eine doppelte steuerliche Belastung durch Anrechnung der gezahlten US-Steuer zu vermeiden. Zu diesem Wechsel (Switch-over) von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode sah sich das FA berechtigt.
Der BFH hielt diese Vorgehensweise jedoch für rechtswidrig und verwies auf den Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen, wonach inländische Steuerpflichtige die Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung für bestimmte ausländische Einkünfte (§§ 7ff. Außensteuergesetz) nicht dadurch umgehen sollen, dass sie anstelle einer von ihnen beherrschten Kapitalgesellschaft eine Betriebsstätte im niedrig besteuernden Ausland zwischenschalten.
Auch die Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft gilt als Betriebsstätte. Wegen der insoweit bezweckten Gleichstellung von Betriebsstätten (Personengesellschaften) und Kapitalgesellschaften hielt es der BFH für erforderlich, dass die inländische Gesellschaft - anders als die Klägerin - die ausländische Personengesellschaft rechtlich oder tatsächlich beherrscht.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wenn eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke verfolgt, stehen ihr vielfältige Steuerbefreiungen und steuerliche Vergünstigungen zu - hervorzuheben sind hier die Befreiungen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Eine Gemeinnützigkeit ist nach der Abgabenordnung bei einer Förderung der Allgemeinheit gegeben - hierunter fällt u.a. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) können auch Online-Plattformen gemeinnützig sein, die es den Nutzern ermöglichen, verschiedenste Petitionen oder Kampagnen zu formulieren und zur elektronischen Abstimmung zu stellen. Geklagt hatte ein Plattform-Betreiber, dem das Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt hatte. Das Amt hatte argumentiert, dass eine Petitions-Plattform nur dann das demokratische Staatswesen fördere, wenn sie ausschließlich an staatliche Stellen gerichtete Anliegen erfasst. Vorliegend konnten aber auch Anliegen online gestellt werden, die an nicht staatliche Stellen adressiert waren.
Der BFH erklärte jedoch, dass das demokratische Staatswesen durch die Online-Plattform durchaus gefördert werden konnte, sofern die Betreiber die dort zur Abstimmung gestellten Anliegen - auch parteipolitisch - neutral und ohne inhaltliche Wertung gefördert und sich dabei innerhalb des allgemeinen Rahmens des Gemeinnützigkeitsrechts bewegt hatten.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss das vorinstanzliche Finanzgericht nun eine erneute gemeinnützigkeitsrechtliche Prüfung durchführen. Der BFH gab dem Gericht hierfür u.a. den zu prüfenden verfassungsrechtlichen Rahmen vor. Danach muss der Bedeutungsgehalt des demokratischen Staatswesens unter Berücksichtigung der Strukturprinzipien der bundesstaatlichen Verfassung (Art. 20 GG) ermittelt werden.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Körperschaftsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Müssen Unternehmen für Mitwirkungshandlungen bei IT-Migration Umsatzsteuer zahlen? Eine Genossenschaftsbank, die regelmäßig IT-Dienstleistungen von einem konzernangehörigen Anbieter bezog, stand vor genau dieser Frage. Im Rahmen der Einführung eines neuen Kernbanksystems war eine umfassende IT-Migration erforderlich. Die Bank war hierbei laut Projektvertrag unter anderem verpflichtet, Personal bereitzustellen, Daten zu pflegen und die Umstellung aktiv zu begleiten. Diese Mitwirkung war unverzichtbar, da der Dienstleister keinen direkten Zugriff auf interne Systeme und Prozesse der Bank hatte. Für ihre Unterstützung erhielt die Bank anschließend eine pauschale Kompensationszahlung je umgestellten Arbeitsplatz.
Das Finanzamt wertete diese Zahlung als steuerpflichtige Gegenleistung für eine Leistung der Bank. Die Bank argumentierte hingegen, dass es sich bei den Mitwirkungshandlungen um projektimmanente, nicht eigenständig wirtschaftlich verwertbare Tätigkeiten gehandelt habe und die Zahlung keine umsatzsteuerpflichtige Gegenleistung, sondern eine reine Unterstützungsleistung gewesen sei.
Das Finanzgericht Münster schloss sich der Auffassung der Bank an und entschied, dass die Kompensationszahlungen nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Die Mitwirkung sei projektimmanent und keine eigenständige steuerbare Leistung gewesen. Der IT-Dienstleister habe durch die Mitwirkung der Bank keinen verwertbaren Vorteil erzielt. Es habe auch kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Mitwirkungshandlungen und der Kompensationszahlung bestanden. Die Kompensation habe ausschließlich der Unterstützung der Bank während der Systemumstellung gedient.
Zudem liege keine Entgeltminderung vor, da die Zahlung unabhängig von den Abrechnungen auf Basis des neuen Servicevertrags erfolgt sei und dessen Bemessungsgrundlage nicht beeinflusst habe. Wirtschaftlich habe es sich um ein Entgelt für den Abschluss des neuen Servicevertrags gehandelt, was als steuerfreie Begründung einer Geldverbindlichkeit zu bewerten sei.
Hinweis: Das Finanzamt hat Revision eingelegt. Die höchstrichterliche Entscheidung steht also noch aus, könnte jedoch grundsätzliche Bedeutung für die umsatzsteuerliche Behandlung vergleichbarer IT-Projekte - auch in anderen Branchen - haben.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Im Bereich digitaler Dienstleistungen, insbesondere beim Vertrieb von Apps, gibt es wichtige Entwicklungen bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Umsätzen vor dem Jahr 2015. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) prüft derzeit, wie diese Umsätze korrekt zu besteuern sind und wer als Leistungserbringer gilt.
Im Besprechungsfall verkaufte ein deutsches Unternehmen Apps über einen Appstore mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Die Apps waren zunächst kostenlos, jedoch konnten kostenpflichtige Zusatzleistungen erworben werden. Nach der vertraglichen Vereinbarung bot der App Store die Produkte im eigenen Namen, aber für Rechnung der App-Entwicklerin an und erhielt dafür eine Provision. Die Endkunden erhielten vom App Store eine Bestellbestätigung, in der das deutsche Unternehmen als Verkäufer genannt und deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Das Unternehmen behandelte seine Leistung an den App Store als Dienstleistungskommission.
Das zuständige Finanzgericht bestätigte zunächst, dass der Leistungsort im Ausland liege und keine deutsche Umsatzsteuer anfalle. Der Bundesfinanzhof stellte diese Sichtweise allerdings in Frage und legte dem EuGH mehrere zentrale Fragen vor:
Der Generalanwalt beim EuGH schlägt eine enge Auslegung vor: Der App Store gilt als Leistungserbringer gegenüber den Endkunden, die Leistung der App-Entwicklerin wird an den App Store erbracht. Leistungsort ist der Sitz des App Stores, nicht der Wohnort des Endkunden. Ein deutscher Umsatzsteuerausweis in Bestellbestätigungen löst, sofern keine Gefährdung des Steueraufkommens besteht, nicht automatisch eine Steuerpflicht aus. Zudem wurde die Frage aufgeworfen, ob Bestellbestätigungen überhaupt als umsatzsteuerliche Rechnungen gelten.
Hinweis: Wir empfehlen Unternehmen, die über digitale Plattformen Umsätze erzielen, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und bei Bedarf ihre umsatzsteuerlichen Abläufe anzupassen.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Die umsatzsteuerliche Behandlung von Subventionen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird derzeit auf europäischer und nationaler Ebene intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob staatliche Zuschüsse zur Verlustdeckung von Verkehrsunternehmen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Anlass ist ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu pauschalen Ausgleichszahlungen an ein polnisches Verkehrsunternehmen.
In ihren Schlussanträgen kommt die Generalanwältin beim EuGH zu dem Ergebnis, dass Verlustausgleichszahlungen nicht der Umsatzsteuer unterliegen, da sie keinen unmittelbaren Bezug zu einer konkreten Leistung haben. Sie seien somit keine Gegenleistung für eine steuerbare Lieferung oder Dienstleistung. Nach der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie sind Subventionen nur dann in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen, wenn sie direkt mit dem Preis der Leistung verknüpft sind. Diese Voraussetzung liegt im Besprechungsfall nicht vor.
Entscheidend für die umsatzsteuerrechtliche Relevanz ist, dass eine steuerbare Subvention einen unmittelbaren Preisbezug hat, sie also an eine konkrete Leistung gebunden ist und deren Preis beeinflusst. Auch der Zweck der Zahlung ist maßgeblich: Zuschüsse, die nur Verluste ausgleichen oder der allgemeinen Unternehmensförderung dienen, gelten als echte Zuschüsse und sind nicht steuerbar. Zudem muss geprüft werden, ob die Zahlung dem Zuschussgeber oder einem Dritten einen konkreten wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine steuerbare Leistung vor.
Auch der Bundesfinanzhof stellte im Jahr 2024 klar, dass Strukturhilfen der Länder keine Umsatzsteuerpflicht auslösen. Das Bundesfinanzministerium hat ergänzend präzisiert, dass maßgeblich ist, ob die Zahlung dem Gemeinwohl dient oder an eine konkrete Leistung gebunden ist. Die Entwicklungen in der Rechtsprechung schaffen mehr Rechtssicherheit: Pauschale Verlustausgleichszahlungen, beispielsweise anhand von Fahrzeugkilometern statt Fahrgastzahlen bemessen, können künftig als nichtsteuerbare Zuschüsse behandelt werden.
Dies bedeutet: keine Umsatzsteuer auf Zuschüsse, volle Verwendung der Mittel, keine Vorsteuerkürzung und ein geringeres Risiko der Umsatzsteuerpflicht bei allgemein und pauschal formulierten Vereinbarungen.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wenn Sie Betriebsvermögen erben oder geschenkt bekommen, können Sie Befreiungen von der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer beantragen. Diese werden unter bestimmten Voraussetzungen gewährt und sollen eine Weiterführung des Betriebs erleichtern, indem für die Zahlung der Steuer nicht Teile des Unternehmens verkauft werden müssen. Da für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch bestimmte Fristen einzuhalten sind, kann die Steuerbefreiung noch rückwirkend entfallen, wenn die Bedingungen nicht mehr vorliegen (beispielsweise wenn sich die Lohnsumme vermindert). Das Finanzgericht Münster (FG) hatte kürzlich über folgenden Fall zu entscheiden:
Der Kläger war Erbe eines Einzelunternehmens. Innerhalb eines Jahres übertrug er dieses im Wege einer Ausgliederung auf die neugegründete O-GmbH. Als Gegenleistung erhielt er alle Geschäftsanteile und eine Darlehensforderung gegen die O-GmbH. Ein Teil der Forderung wurde zum Jahresende in eine Kapitalrücklage der O-GmbH umgewandelt. Nach Ansicht des Finanzamts war die Ausgliederung ein Verstoß gegen die Behaltensfrist, da neben den Geschäftsanteilen zusätzlich eine Darlehensforderung als Gegenleistung gewährt wurde.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Steuervergünstigung entfällt, wenn der Erwerber innerhalb der fünfjährigen Behaltensfrist einen Gewerbebetrieb veräußert. Die Ausgliederung des Einzelunternehmens in die O-GmbH war unschädlich, soweit der Kläger als Gegenleistung Anteile an der O-GmbH erhalten hat. Der Sinn der Steuervergünstigungen ist, dass das Unternehmen nicht ganz oder teilweise in die private Sphäre übertragen wird.
Allerdings ist dies nicht mehr gegeben, wenn neben den Anteilen noch eine Darlehensforderung gegenüber der Gesellschaft eingeräumt wird, weil dadurch das Betriebsvermögen quasi entnommen und wieder als Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird. Es ist für die Beurteilung nicht relevant, dass weiterhin die Buchwerte fortgeführt werden. Entscheidend ist die Darlehensgewährung und die damit einhergehende Verlagerung, die wie ein schädlicher Veräußerungsvorgang gewertet wird.
Hinweis: Die Revision wurde eingelegt. Es zeigt sich, dass bei solchen Unternehmensumstrukturierungen die steuerlichen Folgen immer im Auge behalten werden sollten.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Erbschaft-/Schenkungsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Am 03.04.2025 veröffentlichte der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) seine Schlussanträge zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Verrechnungspreisanpassungen im Konzernkontext. Im zugrundeliegenden Fall war eine Tochtergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat im Bereich Kranvermietung und -verkauf tätig. Die Konzernzentrale in einem anderen Mitgliedstaat übernahm zentrale Management- und Steuerungsfunktionen, einschließlich strategischer Planung, Vertragsverhandlungen sowie Finanz- und Qualitätsmanagement.
Die Leistungen wurden im Rahmen einer Verrechnungspreisvereinbarung auf Basis der Nettomargenmethode (TNNM) abgerechnet. Bei Überschreitung der vereinbarten Gewinnspanne stellte die Zentrale eine Ausgleichszahlung in Rechnung. Die nationale Steuerbehörde sah diese Zahlung als umsatzsteuerpflichtig an, versagte jedoch gleichzeitig den Vorsteuerabzug, da die Tochtergesellschaft die wirtschaftliche Veranlassung und Verwendung der bezogenen Leistungen nicht ausreichend belegen konnte. In der Folge ersuchte das zuständige Gericht den EuGH um Klärung, ob solche Ausgleichszahlungen der Mehrwertsteuer unterliegen und welche Anforderungen an den Nachweis für den Vorsteuerabzug zu stellen sind.
Der Generalanwalt stellte klar, dass die Umsatzsteuerpflicht von Verrechnungspreisanpassungen stets im Einzelfall geprüft werden müsse. Maßgeblich sei, ob ein entgeltliches Rechtsverhältnis zwischen den beteiligten Parteien und ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der erbrachten Leistung und der Gegenleistung bestehe. Im konkreten Fall bejahte der Generalanwalt diese Voraussetzungen: Die konzerninterne Leistungserbringung sei hinreichend bestimmt, der wirtschaftliche Nutzen für die Tochtergesellschaft nachvollziehbar und die Vergütung - trotz Ex-post-Festlegung - aufgrund vertraglich definierter Modalitäten ausreichend konkretisiert.
Bezüglich des Vorsteuerabzugs führte der Generalanwalt aus, dass neben einer ordnungsgemäßen Rechnung auch weitere Unterlagen verlangt werden dürfen. Diese müssen allerdings verhältnismäßig und geeignet sein, die Verwendung der Leistungen für die Zwecke der besteuerten Umsätze des Steuerpflichtigen zu belegen.
Hinweis: Verrechnungspreisanpassungen erfolgen regelmäßig aus ertragsteuerlichen Gründen. Ihre umsatzsteuerliche Behandlung ist bislang uneinheitlich geregelt. Eine Entscheidung des EuGH könnte hier für mehr Rechtsklarheit sorgen, insbesondere für international tätige Unternehmen mit Blick auf Planungssicherheit und Dokumentationspflichten.
| Information für: | Unternehmer |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Informationen für alle
- Achtung, Trickbetrug! Gefälschte Steuerpost fordert zu Zahlungen auf
- Aktuelle Steuerschätzung: Prognostizierte Einnahmen des Staats schrumpfen
- Ambulanter Pflegedienst: Voraussetzungen für eine Gewerbesteuerbefreiung
- Behinderten-Pauschbetrag: Auch Menschen mit Pflegegrad 4 oder 5 profitieren
- Ein gar nicht so feiner Unterschied: Zur Höhe von Aussetzungszinsen bzw. Nachzahlungszinsen
- Familiengenossenschaft: Private Ausgaben sind steuerlich kritisch zu betrachten
- Fehler in finanzgerichtlichen Entscheidungen: Bei greifbarer Gesetzeswidrigkeit ist die Revision zuzulassen
- Fristversäumnis: Grundsätze für die Berechnung von Verspätungszuschlägen
- Sichergestellte Festplatte: Finanzamt darf ungefilterte Daten der Staatsanwaltschaft nicht verwerten
- Vertretungszwang: Sozialrichter kann sich nicht selbst vor dem BFH vertreten
Wer einen Brief vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in seinem Briefkasten vorfindet, vermutet erst einmal einen behördlichen Hintergrund. Bei ihnen ist momentan allerdings erhöhte Vorsicht geboten, denn Betrüger versenden verstärkt Schreiben im Namen des BZSt, in denen sie zu Steuerzahlungen aufgrund der verspäteten Abgabe der Steuererklärung 2023 auffordern.
Die gefälschte Post sieht auf den ersten Blick täuschend echt aus. Bei genauerer Betrachtung fallen jedoch einige Ungereimtheiten auf: Entscheidende Angaben sind in der Regel falsch oder fehlen ganz (z.B. die Steuernummer oder Identifikationsnummer). Auch die Datierung ist mitunter unschlüssig. Auf der ersten Seite wird behauptet, das Finanzamt habe das BZSt beauftragt, diesen Fall zu übernehmen. Weiterhin wird vorgetäuscht, die Steuererklärung für das Jahr 2023 sei zu spät eingegangen.
Aufgrund dieser falschen Tatsachen setzt der Absender einen Verspätungszuschlag fest und beruft sich dabei auf die Steuergesetzgebung. Auffällig ist zudem, dass der Adressat in der Anrede nicht namentlich angesprochen wird - die Schreiben beginnen mit "Sehr geehrte Steuerzahlerin und sehr geehrter Steuerzahler".
Hinweis: Solch allgemeine Anreden sind oft schon ein Hinweis auf Fälschungen. Das Finanzamt kennt den Namen und die Identifikationsnummer des Empfängers und verwendet diese in seiner Kommunikation.
Die zweite Seite der gefälschten Schreiben soll eine Rechnung darstellen. Der Leser wird aufgefordert, 350,11 EUR auf ein Konto zu überweisen. Auf der vermeintlichen Rechnung ist ein QR-Code zu finden, der vermutlich auf eine betrügerische Website von Cyberkriminellen führt. Zudem wird starker Druck aufgebaut, indem erklärt wird, dass der Empfänger nur zwei Tage Zeit habe, um die Überweisung zu tätigen. Sollte keine Zahlung erfolgen, würden den Adressaten weitere finanzielle Strafen drohen; auch von Pfändung ist die Rede.
Bei den Kontoangaben fällt auf, dass es sich nicht um eine deutsche Kontoverbindung handelt. Die IBAN deutscher Konten beginnt immer mit der Buchstabenkombination "DE". Auf dem Betrugsschreiben beginnt die Kontoverbindung indes mit "ES" - was für Spanien steht.
Hinweis: Die Steuerbehörden würden eine Zahlung niemals auf ein ausländisches Konto und nicht innerhalb von zwei Tagen einfordern. Auch mit einer Pfändung würden echte Finanzämter nicht vorschnell drohen. Betrügerische Schreiben lassen sich zudem entlarven, indem die eigene Identifikationsnummer oder Steuernummer mit den im Brief gemachten Angaben verglichen wird. Steuerzahler sollten wissen, dass ausnahmslos das örtliche Finanzamt für die Einkommensteuerveranlagung zuständig ist; das BZSt hat andere Aufgaben. Wer eine Fälschung vermutet, sollte sein zuständiges Finanzamt kontaktieren.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Im Mai 2025 hat die 168. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen stattgefunden. Dieser Arbeitskreis ist ein unabhängiger Beirat des Bundesministeriums der Finanzen, der zweimal im Jahr zusammentritt. Das Expertengremium kam zu dem Ergebnis, dass die erwarteten Steuereinnahmen insgesamt niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung aus Oktober 2024 prognostiziert.
Die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen entwickeln sich unter Berücksichtigung der bis Mai 2025 in Kraft getretenen Steuererleichterungen mit einem Volumen von 979,7 Mrd. EUR in diesem Jahr etwas schwächer als in der Oktober-Schätzung erwartet - über den gesamten Schätzzeitraum bis 2029 liegen die Steuereinnahmen im Vergleich zur Schätzung im Oktober 2024 durchschnittlich jährlich um rund 16 Mrd. EUR niedriger, davon ist mit Mindereinnahmen von durchschnittlich 7 Mrd. EUR für den Bund zu rechnen.
Gegenüber der Oktober-Schätzung ergeben sich diese Mindereinnahmen jedoch insbesondere durch die Berücksichtigung der seit der letzten Schätzung in Kraft getretenen Steuererleichterungen, maßgeblich zur Abfederung der kalten Progression. In den Planungen für den Haushalt sind diese absehbaren Veränderungen bereits berücksichtigt. Für die Haushaltsaufstellung ergeben sich somit keine Änderungen.
Hinweis: Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde. Neben bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen haben die internationalen Handelskonflikte und die US-Zollpolitik die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht.
Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte daher laut Frühjahrsprojektion der Bundesregierung in diesem Jahr in realer Rechnung stagnieren (+ 0,0 %). 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+ 1,0 %). Diese Steigerung wird u.a. durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wenn man selbständig ist, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man erzielt Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb. Entscheidender Unterschied zwischen beiden Varianten ist die Tatsache, dass auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb auch noch Gewerbesteuer gezahlt werden muss. Aber auch wenn man einen Gewerbebetrieb hat, kann es Ausnahmen von der Gewerbesteuer geben. So sind Pflegeheime unter bestimmten Voraussetzungen von der Gewerbesteuer befreit. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste entscheiden, ob diese Regelung auch für ambulante Pflegedienste gilt.
Der Kläger betrieb einen ambulanten Pflegedienst und erzielte damit Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Er erklärte einen positiven Gewerbeertrag und begehrte die Gewerbesteuerbefreiung. Die Pflegekosten für die betreuten Personen seien unter Berücksichtigung der Zahlungen der Beihilfe in mehr als 40 % der Fälle von Sozialversicherungsträgern übernommen worden (Voraussetzung für die Gewerbesteuerbefreiung). Das Finanzamt gewährte jedoch keine Steuerbefreiung. Nach seiner Ansicht wurden die Pflegekosten nicht in mindestens 40 % der Fälle von den Sozialversicherungsträgern übernommen.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Voraussetzungen für die Gewerbesteuerbefreiung lagen dem Gericht zufolge bei der ambulanten Pflegeeinrichtung des Klägers vor. Auch seien im Streitjahr in mindestens 40 % der Fälle die Pflegekosten von den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung oder Sozialhilfe getragen worden. Bei der Ermittlung dieses Prozentsatzes seien auch die Fälle zu berücksichtigen, bei denen die Kosten nicht vollständig, sondern nur überwiegend übernommen wurden.
Zudem sei auch allein die Kostenübernahme durch die Sozialversicherungsträger in 39,51 % der Fälle kaufmännisch auf 40 % aufzurunden, denn im Gesetz finde sich keine spezifische Rundungsregelung. Somit seien die Voraussetzungen der Gewerbesteuerfreiheit erfüllt.
Hinweis: Die Steuerbefreiung soll zu einer Kostenentlastung bei den entsprechenden Einrichtungen führen und als "Verschonungssubvention" mittelbar auch einen Anreiz für die Vornahme von Investitionen in diesem Bereich schaffen.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | Gewerbesteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Eine Behinderung bringt im Alltag häufig erhöhte Kosten mit sich. Um Betroffene steuerlich zu entlasten, gewährt der Fiskus ihnen einen Behinderten-Pauschbetrag. Seit 2021 kann dieser Pauschbetrag bereits ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 20 bei der Einkommensteuerveranlagung beansprucht werden. Es gilt folgende Staffelung:
| GdB | Pauschbetrag in EUR |
| 20 | 384 |
| von 25 und 30 | 620 |
| von 35 und 40 | 860 |
| von 45 und 50 | 1.140 |
| von 55 und 60 | 1.440 |
| von 65 und 70 | 1.780 |
| von 75 und 80 | 2.120 |
| von 85 und 90 | 2.460 |
| von 95 und 100 | 2.840 |
| Blinde, taubblinde und hilflose behinderte Personen | 7.400 |
Wer als pflegebedürftige Person unter schwerster Beeinträchtigung der Selbstständigkeit leidet und in die Pflegegrade 4 oder 5 eingestuft ist, wird einer hilflosen Person mit dem Merkzeichen "H" gleichgestellt und kann daher ebenfalls jährlich 7.400 EUR als Pauschbetrag geltend machen - und zwar ohne einen Grad der Behinderung feststellen lassen zu müssen. Hierfür benötigen die Betroffenen den Bescheid der Pflegekasse, in dem die Einstufung in den Pflegegrad 4 oder 5 dokumentiert ist. Sie müssen keine Feststellung einer Behinderung mit dem Merkzeichen "H" beantragen.
Hinweis: Wer den Behinderten-Pauschbetrag geltend machen möchte, muss zwingend eine Einkommensteuererklärung für das entsprechende Jahr beim Finanzamt abgeben und die Anlage "Außergewöhnliche Belastungen" ausfüllen. Auch wenn ein entsprechender GdB oder Pflegegrad erst Mitte oder Ende eines Jahres festgestellt wird, gewährt das Finanzamt den Pauschbetrag in voller Höhe für das gesamte Jahr.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Schulden Sie dem Finanzamt Geld, müssen Sie nach einer bestimmten Zeit Zinsen auf diesen Geldbetrag zahlen. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob Sie selbst die Aussetzung der Zahlung beantragt haben oder sich die Nachzahlung erst später ergibt. So hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Jahr 2024 entschieden, dass ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat für die Aussetzung eines Geldbetrags unproblematisch ist (dort ging es um den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 15.04.2021). Für Nachzahlungszinsen war in dem Zeitraum nur ein Zinssatz von 0,15 % zu veranschlagen. Das Finanzgericht Köln (FG) musste kürzlich entscheiden, ob diese unterschiedlichen Zinssätze gerechtfertigt sind.
Das Finanzamt setzte gegenüber den Antragstellern Aussetzungszinsen für die Monate Februar 2023 bis November 2024 fest und legte hierbei einen monatlichen Zinssatz von 0,5 % zugrunde. Die Antragsteller legten Einspruch ein und beantragten, die Zinsen in Höhe von 0,35 % (Differenzbetrag zwischen 0,5 % und 0,15 %) von der Vollziehung auszusetzen. Sie begründeten dies - unter Berufung auf den BFH-Beschluss aus dem Jahr 2024 - mit ernstlichen Zweifeln an der unterschiedlichen Verzinsung von Aussetzungs- und Nachzahlungszinsen.
Das Finanzamt lehnte den Antrag ab und verwies darauf, dass sich der BFH-Beschluss nur auf Zinsen für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 15.04.2021 beziehe. Auch gebe es spätestens seit dem 01.01.2023 keine Niedrigzinsphase mehr.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Antragsteller müssen die geforderten weiteren Zinsen vorläufig nicht zahlen. Das FG hat schon deshalb hinreichende Zweifel an der Höhe der angefochtenen Zinsen, da der BFH eine von der Ansicht der Finanzverwaltung abweichende Auffassung vertritt. Nicht nur eine anhaltende Niedrigzinsphase habe laut BFH Zweifel an der Höhe des Zinssatzes für Aussetzungszinsen begründet, vielmehr habe der BFH auch die unterschiedliche Höhe der Zinssätze ab 2019 beanstandet. Daher sind nach Auffassung des Gerichts ernstliche Zweifel angebracht, wenn über die Höhe der Aussetzungszinsen gestritten wird.
Hinweis: Das Finanzamt hatte die Möglichkeit, gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen, nahm diese jedoch nicht wahr.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
In jüngster Zeit werden zunehmend sogenannte Familiengenossenschaften gegründet. Diese bestehen im Kern aus Angehörigen einer Familie und sind dadurch gekennzeichnet, dass sie umfangreiche Aufwendungen tätigen, die der privaten Lebensführung ihrer Mitglieder zugerechnet werden können. Dazu zählen beispielsweise Kosten für Fahrzeuge, Urlaubsreisen, Freizeitaktivitäten, maßgeschneiderte Kleidung, Haustiere oder Bauvorhaben wie Garagen, Saunen oder Swimmingpools auf den Grundstücken der Mitglieder.
Die Mitglieder (und Steuerpflichtigen) dieser Familiengenossenschaften vertreten gemeinhin die Ansicht, dass solche Aufwendungen zulässig und als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Sie stützen dies auf § 1 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz, wonach die Genossenschaft den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale und kulturelle Belange fördern soll. Daraus folgern sie auch eine volle Abzugsfähigkeit der Vorsteuer.
Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) gibt hierzu eine differenzierte Stellungnahme ab. Im Folgenden wird lediglich die umsatzsteuerliche Behandlung betrachtet. Die Beurteilung des Vorsteuerabzugs von Familiengenossenschaften erfolgt ausschließlich auf Grundlage umsatzsteuerlicher Prinzipien, wobei maßgeblich ist, ob die Aufwendungen für unternehmerische oder für unternehmensfremde Tätigkeiten verwendet werden.
Ein Vorsteuerabzug ist nur für Leistungen zulässig, die für ein Unternehmen und dessen unternehmerische Tätigkeit eingesetzt werden. Aufwendungen, die der privaten Förderung der Mitglieder dienen, sind dem unternehmensfremden Bereich zuzuordnen und schließen folglich einen Vorsteuerabzug aus. Dabei ist es unerheblich, wie der Unternehmensgegenstand in der Satzung definiert ist oder wie das genossenschaftsrechtliche Verständnis der wirtschaftlichen Tätigkeit ausgestaltet ist.
Hinweis: Das BayLfSt bewertet Aufwendungen von Familiengenossenschaften, die der privaten Lebensführung der Mitglieder dienen, aus steuerlicher Sicht kritisch. Umsatzsteuerlich ist ein Vorsteuerabzug für diese Aufwendungen ausgeschlossen, da sie dem unternehmensfremden Bereich zuzurechnen sind.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | Umsatzsteuer |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Wer in einem Rechtsstreit vor dem Finanzgericht (FG) unterliegt, hat häufig die Möglichkeit, sich mit einer Revision an den Bundesfinanzhof (BFH) zu wenden. Nach der Finanzgerichtsordnung muss eine Revision u.a. zugelassen werden, wenn sie der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient. Dies ist bspw. der Fall, wenn das Finanzgericht in seiner Entscheidung eine offensichtlich entscheidende Vorschrift außer Acht gelassen hat. Ein neuer Fall des BFH zeigt, wie eine solche greifbare Gesetzeswidrigkeit aussehen kann.
Vorliegend hatten zusammen veranlagte Eheleute gegen die Festsetzung eines Verspätungszuschlags geklagt. Das Niedersächsische FG hatte die Klage abgewiesen, sich aber nicht mit den Vorschriften der Abgabenordnung befasst, die für die Zuschlagsfestsetzung gegenüber mehreren Personen gelten.
Auf die Beschwerde der Eheleute hin ließ der BFH nun die Revision zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu. Die Bundesrichter sahen in der finanzgerichtlichen Entscheidung eine greifbare Gesetzeswidrigkeit. Da das FG die Vorschriften zur Zuschlagsfestsetzung gegenüber mehreren Personen komplett ausgeblendet hatte, obwohl diese im Fall der klagenden Eheleute entscheidungserheblich waren, litt das FG-Urteil an einem qualifizierten Rechtsfehler, der im allgemeinen Interesse einer Korrektur durch das Revisionsgericht bedarf. Das Urteil war in einem solchen Maße fehlerhaft, dass das Vertrauen in die Rechtsprechung nur durch eine höchstrichterliche Korrektur wiederhergestellt werden kann.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Das Steuerrecht gibt bestimmte einzuhaltende Fristen vor, sei es für Steuerklärungen oder auch Voranmeldungen. Werden diese überschritten, kann das Finanzamt Verspätungszuschläge festsetzen. Damit soll dem Steuerpflichtigen ein Fristversäumnis "schmerzhafter" gemacht und er zur Einhaltung der Frist beim nächsten Mal angeleitet werden. Aber wie berechnet sich eigentlich dieser Verspätungszuschlag? Macht es einen Unterschied, ob man die jährliche Umsatzsteuererklärung oder die monatliche/quartalsweise Umsatzsteuer-Voranmeldung zu spät abgibt? Das Finanzgericht Köln (FG) musste im Streitfall entscheiden, ob das Finanzamt die Höhe des Verspätungszuschlags richtig ermittelt hatte.
Die Klägerin im Besprechungsfall betreibt ein Handelsunternehmen. Sie war in den Jahren 2018 und 2019 zur monatlichen Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen verpflichtet. Die zunächst bestehende Dauerfristverlängerung für die Abgabe wurde auf Antrag der Klägerin zum 08.04.2019 beendet. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Juli 2019 reichte sie erst am 10.09.2019 beim Finanzamt ein. Da sie bereits vorher Voranmeldungen verspätet abgegeben hatte, setzte das Finanzamt einen Verspätungszuschlag für Juli 2019 fest. Die Klägerin legte gegen die Höhe des Zuschlags Einspruch ein.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags richtet sich nach dem Gesetz. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist monatlich oder vierteljährlich abzugeben und bezieht sich nicht auf ein Kalenderjahr. Die Klägerin kam ihrer Pflicht zur Abgabe der Voranmeldung für Juli 2019 nicht fristgerecht nach. Sie hat auch keine Entschuldigungsgründe vorgetragen. Die Höhe des Verspätungszuschlags bemisst sich nach dem Gesetz. Maßgebend sind Dauer und Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der Steuer. Das Finanzamt hat das ihm dabei eingeräumte Ermessen nach Ansicht des Gerichts fehlerfrei ausgeübt. Somit ist die Höhe nicht zu beanstanden.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
In Zeiten, in denen die Kommunikation innerhalb von Unternehmen weitestgehend digital stattfindet, sind Festplatten ein wahrer Datenschatz, für den sich auch das Finanzamt interessiert. Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt aber, dass die Daten im Besteuerungsverfahren einem Verwertungsverbot unterliegen können, wenn die jeweilige Festplatte in einem Ermittlungsverfahren außerhalb von Steuerstraftraten sichergestellt worden ist und von der Staatsanwaltschaft ungefiltert übersandt wird.
Im zugrunde liegenden Fall ging es um einen Unternehmenskomplex, in den eine Kapitalgesellschaft nach zypriotischem Recht eingebunden war. Das Finanzamt (FA) beschäftigte sich im Rahmen einer bei der deutschen Anteilseigner-Gesellschaft stattfindenden Außenprüfung mit der Frage, ob die geschäftliche Leitung der zypriotischen Gesellschaft faktisch von Deutschland aus erfolgt war, so dass hierzulande eine unbeschränkte Steuerpflicht bestand. Der Prüfer richtete ein Amtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft, die gegen die Akteure bereits Ermittlungsverfahren wegen Vergehen nach dem Gesetz über den Wertpapierhandel führte.
Die Staatsanwaltschaft übersandte dem Prüfer eine im Ermittlungsverfahren sichergestellte Festplatte mit dem gespeicherten E-Mail-Verkehr der beteiligten Akteure; sie hatte die Daten vorher jedoch nicht nach relevanten Informationen gefiltert. Das FA leitete aus den Daten schließlich her, dass der zypriotische Geschäftsführer im Tagesgeschäft keine maßgebliche Rolle gespielt hatte und die Geschäfte faktisch von Deutschland aus geleitet worden waren.
Der BFH entschied nun, dass die Daten der sichergestellten Festplatte im Besteuerungsverfahren einem Verwertungsverbot unterlagen. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft die Festplatte auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses rechtmäßig in Besitz genommen, einer Auswertung durch das FA stand jedoch entgegen, dass die Staatsanwaltschaft die Daten vor der Übersendung nicht durchgesehen hatte und somit nicht die für die strafrechtliche Ermittlung irrelevanten Daten herausgefiltert hatte. Die Durchsicht von Papieren und elektronischen Speichermedien obliegt nach der Strafprozessordnung der Staatsanwaltschaft und bezweckt, dass nur verfahrensrelevante Informationen für eine vertiefte Analyse greifbar bleiben.
Eine übermäßige Datenerhebung soll vermieden werden. Die Übersendung der Festplatte ohne vorherige Filterung durch die Staatsanwaltschaft stellte nach Auffassung des BFH einen unverhältnismäßigen Grundrechtseingriff dar und führte zu einem qualifizierten materiell-rechtlichen Verwertungsverbot.
Hinweis: Der Grundrechtsschutz hinderte das FA somit daran, die Daten der Festplatte im Besteuerungsverfahren zugrunde zu legen. Ob auch ohne die Daten von einer unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland ausgegangen werden kann, muss das vorinstanzliche Finanzgericht nun in einem zweiten Rechtsgang klären.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)
Während Steuerzahler einen Rechtsstreit vor den Finanzgerichten noch selbst führen dürfen, müssen sie sich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zwingend durch einen Prozessbevollmächtigten wie bspw. einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt vertreten lassen, denn hier gilt der sog. Vertretungszwang.
Hinweis: Diese Regelung aus der Finanzgerichtsordnung soll sicherstellen, dass Rechtsbehelfe und Rechtsmittel vor dem BFH nur von Fachleuten eingelegt werden, die in der Lage sind, die Prozesssituation richtig einzuschätzen und das Verfahren sachgerecht zu führen. So soll zum einen das Gericht vor einer Flut unnötiger Prozesse geschützt und zum anderen auch der rechtssuchende Steuerzahler abgesichert werden, indem ihm fach- und sachkundige Vertreter zur Seite gestellt werden.
Nach einem neuen Beschluss des BFH gilt der Vertretungszwang vor dem BFH auch für einen aktiven Richter, der in eigener Sache vor dem BFH prozessiert. Geklagt hatte ein aktiver Sozialrichter, der sich selbst vertreten wollte. Der BFH erklärte jedoch, dass der Schutz des rechtssuchenden Steuerzahlers unterlaufen würfen, wenn bereits eine nachgewiesene juristische Ausbildung den Vertretungszwang aushebelt. Aktive oder pensionierte Richter dürfen daher nicht als Vertreter zugelassen werden. Der Vertretungszwang verletzt nach Gerichtsmeinung auch nicht die verfassungsrechtlich garantierte Rechtsschutzgarantie, denn die Anrufung des BFH wird durch den Zwang nicht unzumutbar erschwert.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 08/2025)